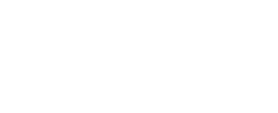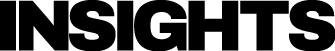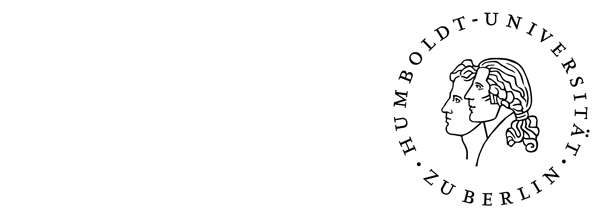Innerhalb der letzten Jahrzehnte befinden sich populistische Parteien im Aufschwung. Während sie um das Jahr 2000 in europäischen Demokratien nur auf etwa 12% der Stimmen kamen, konnten sie 2018 bereits 28% der Wähler:innen in Europa von sich überzeugen.
Doch wie lässt sich die Ideologie dieser Parteien definieren? Was unter Populismus verstanden wird, ist in der Forschung umstritten. Jedoch findet die Definition des Populismus-Forschers Cas Mudde breite Zustimmung. Aus populistischer Sicht ist die Gesellschaft in zwei homogene antagonistische Gruppen unterteilt: Das „einfache Volk“ auf der einen Seite und die Eliten auf der anderen. Während die Eliten als arrogant, faul, verantwortungslos und korrupt gelten, wird das einfache Volk als unschuldig und den Eliten ausgeliefert betrachtet. Populist:innen zufolge solle sich der generelle Wille des Volkes in der Politik widerspiegeln.
Die politikwissenschaftliche Forschung zeigt, dass die Unterstützung von Parteien mit dieser populistischen Ideologie desto höher ausfällt, je gravierender die ökonomische Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft ist.
In ihrer neuen Studie haben sich die HU-Professor:innen Heike Klüver und Johannes Giesike sowie Lukas F. Stötzer, Professor an der Universität Witten-Herdecke, tiefergehend mit diesem Zusammenhang beschäftigt, der bislang nicht hinreichend erklärt werden kann. Neben ihrer Professur ist Heike Klüver Direktorin des Humboldt Governance Lab, dem auch Lukas F. Stötzer angehört.
Die Wissenschaftler:innen vertreten die Ansicht, dass es weniger tatsächliche ökonomische Disparitäten sind, die zur Stärkung des Populismus führen. Bereits die Wahrnehmung, dass eine ungleiche Gesellschaftsordnung vorliegt, bewirke die Ausbreitung populistischer Einstellungen und damit eine gesteigerte Unterstützung für populistische Parteien.
Die Wahrnehmung darüber, wie ungleich eine Gesellschaft ist, kann dabei stark zwischen Individuen variieren und stimmt meist nicht mit der tatsächlichen gesellschaftlichen Ungleichheit überein. So neigen Menschen dazu, die Ungleichheit einer Gesellschaft zu unterschätzen. Dennoch besteht ein klarer positiver Zusammenhang zwischen wahrgenommener und tatsächlicher gesellschaftlicher Ungleichheit.
Die Studie der Forscher:innen, die sich auf Daten des International Social Survey Progamme (ISSP) stützt, zeigt, dass auch die Unterstützung populistischer Parteien und wahrgenommene gesellschaftliche Ungleichheit in einem Zusammenhang stehen. So entscheiden sich Menschen, die die Gesellschaft als ungerechter wahrnehmen, um 2,7 Prozentpunkte eher zur Wahl einer populistischen Partei als Personen, die die Gesellschaft als vergleichsweise gerecht bewerten.
Die Effekte fallen dabei besonders stark für große rechte populistische Parteien aus, wie bspw. die Fortschrittspartei in Norwegen, die Dänische Volkspartei oder die Freiheitspartei Österreichs.
Mit ihrer Studie leisten die Wissenschaftler:innen einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung essenzieller politikwissenschaftlicher Fragen zum Aufstieg des Populismus. Im Gegensatz zur bisherigen Forschung zeigt das Forscher:innenteam, dass die Wahrnehmung der Gesellschaft als ungleich ein elementarer Erklärungsansatz für die ansteigende Unterstützung populistischer Parteien sein kann.